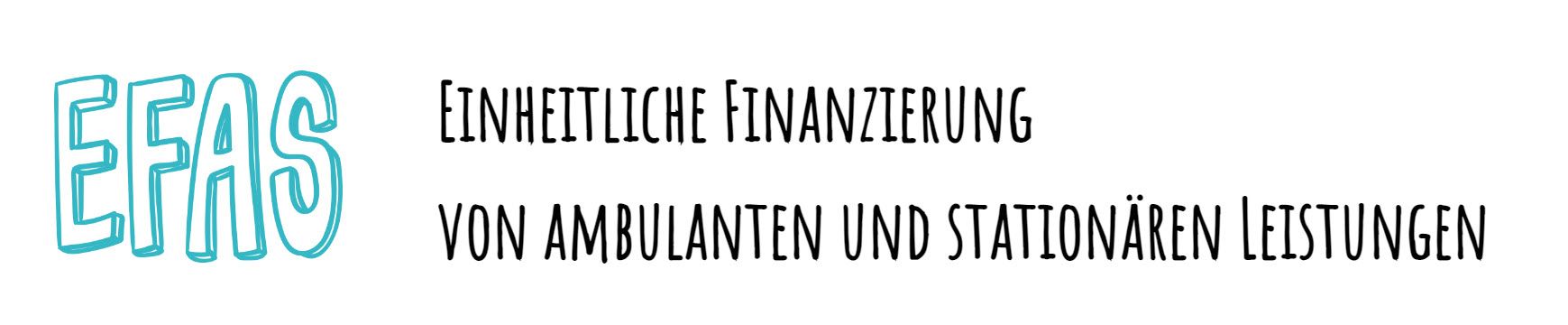
AMBULANT UND STATIONÄR: DIE EFAS-REFORM IM FOKUS
Eine wegweisende Reform zeichnet sich ab: Die einheitliche Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen steht im Fokus der Diskussionen im Schweizer Gesundheitswesen. Welche Auswirkungen hat der Systemwechsel?
Es handelt sich um die grundlegendste Reform im Gesundheitswesen seit Langem: die einheitliche Finanzierung der ambulanten und stationären Leistungen (Efas). Die Vorlage, die auf eine parlamentarische Initiative von Nationalrätin Ruth Humbel aus dem Jahr 2009 zurückgeht, zielt darauf ab, die aktuellen Fehlanreize zu beseitigen.
Derzeit werden ambulante und stationäre Leistungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung unterschiedlich finanziert. Ambulante Leistungen werden vollständig von den Prämienzahlenden getragen, während stationäre Leistungen von den Krankenversicherern und Kantonen gemeinsam finanziert werden. Die Kantone, und damit die Steuerzahlenden, übernehmen dabei 55 Prozent der Kosten, während die Krankenversicherer bzw. Prämienzahlenden 45 Prozent tragen.
Das aktuelle System kann ungünstige Folgen haben: «Es kann vorkommen, dass aus Sicht des Krankenversicherers eine stationäre Behandlung günstiger ist als eine ambulante, da er ja nur 45 Prozent der Kosten tragen muss», sagt Guido Klaus, verantwortlich bei Zur Rose für Public Affairs. Das sei paradox, denn eigentlich sollte die Förderung ambulanter Behandlungen angestrebt werden, da diese per se kostengünstiger wären. Die Krankenversicherer haben derzeit in der Tat schlichtweg keinen Anreiz, die möglicherweise kostengünstigere ambulante Leistung einzufordern, was natürlich nicht im Interesse der Prämienzahlenden ist.
Der Grundsatz «ambulant vor stationär» wurde unlängst auch vom Bund beschlossen. Die Regelung soll eine angemessene ambulante Leistungserbringung fördern, wo sie medizinisch sinnvoll, patientengerecht und ressourcenschonend ist. Fortschritte in der Medizin und die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten sind die Haupttreiber für die Verlagerung von Leistungen vom stationären in den ambulanten Sektor. Aktuell muss die Veränderung jedoch allein von den Prämienzahlenden geschultert werden. Und da Prämien im Unterschied zu Steuern nicht einkommensabhängig sind, belastet die schleichende Ambulantisierung Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen überproportional stark.
Integrierte Versorgung soll gestärkt werden
Vor seiner Zeit bei Zur Rose war Guido Klaus zwanzig Jahre lang in der Krankenversicherungsbranche tätig und hat das Efas-Projekt mitentwickelt. Er ist überzeugt, dass die einheitliche Finanzierung zahlreiche positive Auswirkungen haben wird. Neu würden sich die Kantone mit 25 Prozent an allen Kosten beteiligen, unabhängig davon, wo diese anfallen. Dies führe zu einer zusätzlichen Verlagerung von stationären zu ambulanten Behandlungen, was zu einer Senkung der Gesamtkosten führen werde. Zudem werde die Entwicklung innovativer Versicherungsmodelle gefördert. «Es würde mehr Dynamik und Wettbewerb in diesem Bereich stattfinden. Man erwartet, dass die integrierte Versorgung einen Schub erhält.»
«Wenn heute ein Hausarzt einen Patienten gut betreut und begleitet und dadurch eine Spitaleinweisung vermeidet, profitiert primär der Kanton, da dieser ja zu 55 Prozent den Spitalaufenthalt finanzieren müsste», sagt Klaus. Gleichzeitig können für den Versicherer Mehrkosten entstehen, weil eine gute ambulante auch etwas kostet. Mit Efas werden die Kantone nur noch ca. 25 Prozent der stationären Aufenthalte finanzieren, beteiligen sich aber gleichermassen auch an den ambulanten Kosten. Im gleichen Atemzug wird für den Versicherer das stationäre Setting massiv teurer: Sein Kostenanteil im Spital steigt von 45 Prozent auf 75 Prozent. Damit würde die integrierte Versorgung gestärkt, denn es ist erwiesen, dass gute integrierte Versorgung unnötige Spitaleinweisungen verhindern kann.
Auf der Zielgeraden gilt es, vor allem zwei Interessengruppen zu überzeugen. Einerseits sind das die Kantone, die Mehrkosten befürchten, da sie im neuen System ambulante Leistungen mitfinanzieren müssten. Andererseits sind es die Versicherer, die sich dagegen wehren, dass auch die Langzeitpflege in die einheitliche Finanzierung einbezogen wird. Da der Pflegebedarf aufgrund der demografischen Entwicklung steigen wird, befürchten die Versicherer steigende Pflegekosten.
Tipp: Erklärfilm von Curafutura
Weitere Informationen der Leistungserbringerorganisationen und Versicherer finden Sie hier.
Nutzungsbedingungen
Abonnieren
Report absenden
Meine Kommentare